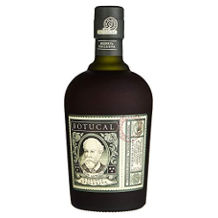Bier Kaufberatung: So wählen Sie das richtige Produkt
- Das Wichtigste in Kürze
- Bier wird hierzulande üblicherweise nach dem Reinheitsgebot aus Wasser, Gerste, Hopfen und Hefe gebraut.
- Die Craftbeer-Szene verzichtet auf das Reinheitsgebot und setzt stattdessen auf die Verwendung verschiedener natürlicher Zutaten.
- Obergärige Biere werden bei hohen Temperaturen gebraut, während untergärige Biere während des Brauprozesses gekühlt werden.
- Der Geschmack und das Aroma eines Bieres lassen sich an der Stammwürze, der Farbe und dem Bitterstoffgehalt erkennen.
- Nach dem Reinheitsgebot gebrautes Bier enthält viele Kalorien und Kohlenhydrate, dafür kaum Zucker und weder Fett noch Salze.

Skål, Prost und Cheers
Bier ist seit tausenden von Jahren ein kulinarischer Begleiter des Menschen. Das aus Wasser, Gerste, Hopfen und Hefe gewonnene Getränk erfreut sich auch heute ungebrochener Beliebtheit. Mittlerweile gibt es tausende Brauereien weltweit. Die Wiege des Biers ist Europa. Auch heute noch gibt es hier viele große Bierregionen, von den böhmisch-tschechischen Gebieten über die deutschsprachigen Länder bis in den Norden Frankreichs, die Benelux-Staaten sowie Großbritannien und Irland. Europäisches Bier gehört nicht ohne Grund zu den besten Biersorten der Welt. Die klimatischen Bedingungen sind optimal für das Wachstum der Zutaten und das Reinheitsgebot gewährleistet die Qualität traditioneller Braukunst. Im internationalen Bereich setzt sich die Craftbeer-Szene immer mehr durch, die dem Reinheitsgebot den Rücken zuwendet und die individuelle Natürlichkeit eines Bieres in den Vordergrund stellt.
Viele Menschen haben ihr Lieblingsbier, das sie geschmacklich am meisten anspricht: Stammwürze, Farbe und Bitterstoffgehalt spielen hierbei eine wichtige Rolle. Wenn Sie Ihr nächstes Bier kaufen, haben Sie ein Auge darauf, ob es sich um ein ober- oder ein untergäriges Bier handelt. Auch Leicht- und Nährbiere sowie alkoholfreie Biere und Craftbeers sind erhältlich.
Was ist das Reinheitsgebot?
Das Reinheitsgebot schreibt vor, dass Brauereien in Deutschland bestimmte Herstellungsvorschriften einhalten müssen. Im Jahre 1516 verfügte die Stadt Ingolstadt, dass Bier nur aus drei Zutaten gebraut werden darf, um die Qualität des alkoholhaltigen Trunks zu gewährleisten: Wasser, Hopfen und Gerste, genau genommen Braugerste, galten als die Bestandteile, die ein wahres Bier ausmachen. Im Gegensatz zu Futtergerste ist Braugerste zum Brauen geeignet; das kurz gekeimte und wieder getrocknete Getreide wird als Malz bezeichnet. Die vierte Zutat ist Hefe, deren Bedeutung erst einige Zeit später erkannt wurde. Seinerzeit war die Wirkung von Hefe noch nicht bekannt. Mit der Zugabe von Hefe zum Bier war das Reinheitsgebot geboren.

Diese unvergleichliche Brautradition findet mittlerweile weltweite Anerkennung. Um stets für die Branche einzutreten, gründete sich 1871 der Deutsche Brauer-Bund. Auch heute noch macht sich die Vereinigung für die Interessen der Landwirtschaft und den Erhalt des Reinheitsgebots stark. Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist das Gebot jedoch etwas gelockert worden: Beispielsweise gilt seit 1968 auch Hopfenextrakt als zulässige Zutat für Bier.
Die vier Säulen guten Bieres
Wasser, Malz, Hopfen und Hefe sind die vier Hauptbestandteile traditionellen Biers. Jede Zutat für sich bringt ihre einzigartigen Eigenschaften in die geschmackliche Gesamtkomposition des Biers mit ein.

Wasser
Bier besteht zu mehr als 90 Prozent aus Wasser. Das Gebot schreibt vor, dass das Wasser Trinkwasserqualität haben muss. Deshalb besitzen viele Brauereien einen eigenen Quellbrunnen, um Mineralwasser zu fördern. Die Mineralstoffe im Wasser haben Einfluss auf den Brauprozess: Sie beeinflussen die Haltbarkeit, die Schaumqualität und den Geschmack. Weiches Wasser resultiert in hellem, hopfenbetontem Bier, während hartes Wasser für Bier mit dunkler und voller Note sorgt.

Malz
Die Braugerste beziehungsweise das Malz ist der Grundstein für die Farbe und den Körper eines Bieres. Die Veredelung von Getreide zu Malz ist ein aufwendiger Prozess, weshalb jeder Brauer und jede Bräuerin zusätzlich eine Ausbildung im Mälzer-Handwerk machen muss. Die zur Keimung gebrachten Gerstenkörner werden getrocknet. Je nach Länge der Trocknungszeit verändern sich das Aroma und die Farbe des Bieres. Es gibt über 40 verschiedene Malzsorten, aus denen BraumeisterInnen wählen können.

Hopfen
Hopfen prägt den Charakter eines Bieres und sorgt für das spezifische Aromaprofil. Zudem bestimmt er, wie bitter das Endprodukt ist und wie sich die Schaumkrone entwickelt. Der Hopfen sorgt für die Haltbarkeit des Bieres. BraumeisterInnen haben die Wahl aus über 200 verschiedenen Hopfensorten, um das gewünschte Aromaprofil zu kreieren. Die verwendete Menge an Hopfen sowie der Zeitpunkt der Zugabe sind für das Resultat entscheidend.
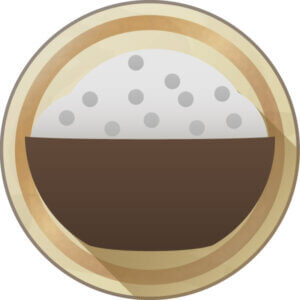
Hefe
Was einst als Wunder der Natur galt, ist heute der natürlichen Eigenschaft der Hefe zuzuschreiben: die Gärung. Die Hefe wandelt den im Malz enthaltenen Zucker im Gärprozess in Alkohol und Kohlensäure um. Dieser Vorgang wirkt sich ebenfalls auf das Aroma aus. Welcher der etwa 200 Hefestämme genutzt wurde, lässt sich im Endprodukt riechen und schmecken. Obergärige Hefen sorgen für einen fruchtigeren Bierstil, während untergärige Hefen bei sogenannten schlanken Bieren Verwendung finden.
Bewusster Genuss
Die meisten Biersorten enthalten Alkohol, weshalb ein bewusster Genuss sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit den Getränken zwingend sind. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist Bier hierzulande verboten. Auch Schwangere und stillende Mütter sollten auf alkoholhaltige Getränke verzichten, da sich der Alkohol negativ auf Un- und Neugeborene auswirken kann. Am Steuer, bei der Arbeit und in Verbindung mit Medikamenten ist Alkohol ebenfalls tabu.
Die Brauweise
Während des Brauprozesses erhält das Bier verschiedene Eigenschaften, die durch bestimmte Werte ausgedrückt werden. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über den Geschmack eines Bieres.
Die Stammwürze
Die Stammwürze des Bieres bezeichnet den Nährstoffgehalt, bevor die Gärung einsetzt. Es handelt sich also um einen entscheidenden Einflussfaktor für den Alkoholgehalt eines Bieres: Je höher der Stammwürzegehalt ist, desto mehr Hefe wurde vergoren und desto höher ist der Alkoholgehalt. Auch ein intensiverer und vollmundigerer Geschmack gehen damit einher. Während der Gärung werden weitere Extrakte wie Aminosäuren, Eiweiße und Vitamine freigesetzt. Des Weiteren wirkt sich die Menge des verwendeten Wassers auf die Stammwürze aus. Der Stammwürzegehalt beschreibt folglich die Dichte der Nährstoffe innerhalb des noch „rohen“ Bieres.
Jedoch kann der Stammwürzegehalt nicht als Qualitätsindikator für alle Biersorten übergreifend genutzt werden. Wenn Sie beim Kauf eines Bieres auf die Stammwürze achten und zwei Biere miteinander vergleichen möchten, sollten diese derselben Sorte angehören.
| Biersorte | Durchschnittlicher Stammwürzgehalt (in Prozent) |
|---|---|
| Stout | 9 bis 16 |
| Gose, Pils, Kölsch | 10 bis 12 |
| Märzen | 11 bis 13 |
| American Ale, Lagerbier, Altbier, Weißbier | 11 bis 14 |
| Pale Ale | 16 bis 18 |
| Porter, India Pale Ale (IPA) | 16 bis 19 |
| Tripel Bier | 18 bis 21 |
| Quadrupel | 18 bis 28 |
Die Farbe
Seine markante Färbung erhält ein Bier während des Brauprozesses. Die Farbe hat Auswirkungen auf den Geschmack. Der Farbwert eines Bieres wird in EBC angegeben, was „European Brewery Convention“ bedeutet. Je mehr dunkles Malz ein Braumeister verwendet, desto dunkler ist letztendlich das Bier. Das Malz wiederum nimmt seine Farbe im Prozess des Darrens an, also im Laufe der Trocknung und je nach Temperatur. Auch andere Zutaten, wie etwas dunkler Kandiszucker, können einem Bier eine dunkle Färbung geben.

Es gibt aber auch einige Ausnahmen, weshalb die Farbe nicht immer auf die Biersorte schließen lässt. Vor allem zu Zeiten des Craftbeers haben sich einige BrauerInnen daran versucht, der Norm zu entgehen und neue Kreationen geschaffen. Ein Black IPA ist beispielweise ein „dunkles Blondes“, bei dem die feine Karamellnoten im Vordergrund stehen, die Farbe jedoch dunkelbraun ist. Ein White Stout ist hingegen ein Starkbier, das sich durch kräftige Malzaromen auszeichnet, allerdings eine goldgelbe Farbe hat.
Der Bitterstoffgehalt
Der Bitterstoffanteil eines Bieres wird entweder durch die Abkürzung BE (Bittereinheiten) oder IBU (International Bitterness Units) ausgedrückt. Im Braugewerbejargon ist es üblich, von Bittere und nicht von Bitterkeit zu sprechen; beispielsweise kann eine Hopfensorte einem Bier eine besonders weiche Bittere geben. Die Bittere wird durch den Hopfen bestimmt, den ein Brauer oder eine Brauerin verwendet. Durch die Hitzeentwicklung beim Kochen lösen sich aus dem Hopfen Säuren, die unterschiedliche Mengen an Bitterstoffen freisetzen. Die Bittere beeinflusst den Charakter sowie das Aromaprofil eines Bieres und wird vorab von BraumeisterInnen errechnet. So können sie sich sicher sein, dass der Wert für die jeweilige Biersorte am Ende des Prozesses weder über- noch unterschritten wird.
| BE- beziehungsweise IBU-Wert | Beispielhafte Biersorte |
|---|---|
| Unter 10 | Berliner Weisse |
| 10 bis 20 | Weißbier |
| 20 bis 30 | Export, Kölsch, Schwarzbier |
| 25 bis 35 | Bockbier |
| 20 bis 45 | Porter, Pils |
| 30 bis 60 | Stout |
| 40 bis 150 | India Pale Ale |
Welche Biersorten gibt es?
Die verschiedenen Biersorten werden vorrangig in ober- und untergärige Biere unterteilt. Darüber hinaus gibt es diverse Biere, die sich dieser Gliederung entziehen – so zum Beispiel Leichtbiere, alkoholfreie Biere und Nährbiere. Craftbeers sind eine Klasse für sich, da ober- und untergärige Biere vor allem auf der Brautradition und dem Reinheitsgebot beruhen. Die Craft-Szene entzieht sich diesem Brauch und schafft sowohl das eine als auch das andere, ohne die entstehenden Sorten nach ober- oder untergärig zu klassifizieren.
Was sind obergärige Biere?
Obergärige Biere werden mit Hefe gebraut, die bei moderaten bis warmen Temperaturen am besten „arbeitet“: Der Zucker wird bei 15 bis 20 Grad Celsius in Alkohol umgewandelt. In den meisten Fällen setzt sich obergärige Hefe zudem an der Oberfläche des Bieres ab. Das ist jedoch nicht immer der Fall, weshalb die Gärungstemperatur den ausschlaggebenden Unterscheidungsfaktor darstellt.
Berliner Weisse
Dieser Name darf nur von Berliner Brauereien genutzt werden. Bei der Weisse handelt es sich um ein schlankes Bier, das eine leicht trübe Farbe und einen säuerlichen Geschmack hat. Bei einer Trinktemperatur von acht bis zehn Grad Celsius wird es gern im Sommer mit einem Schuss Himbeer- oder Waldmeistersirup getrunken.
- Alkoholgehalt: 2 bis 3 Prozent
- Stammwürzegehalt: 7 bis 8 Prozent
- Bitterstoffgehalt: 3 bis 8
- EBC-Wert: 5 bis 8
Kölsch
Die Kölner Spezialität, deren Bezeichnung ein rechtlich geschützter Markenname ist und nur von Kölner Brauereien verwendet werden darf, ist ein helles und schlankes Vollbier. Das Bier hat nur wenige Malzaromen; sein Geschmack wird eher als „süffig“ bezeichnet.
- Alkoholgehalt: 4 bis 5 Prozent
- Stammwürzegehalt: 11 bis 12 Prozent
- Bitterstoffgehalt: 20 bis 25
- EBC-Wert: 6 bis 9
Weißbier
Bei dem auch als Weizenbier bekannten Getränk müssen während der Herstellung mindestens 50 Prozent Weizenmalz verwendet werden; der Rest ist entweder Gerstenmalz oder das Bier wird komplett aus Weizenmalz gebraut. Das Bier gärt in den Flaschen nach und erhält einen leicht fruchtigen Geschmack.
- Alkoholgehalt: 5 bis 6 Prozent
- Stammwürzegehalt: 11 bis 14 Prozent
- Bitterstoffgehalt: 10 bis 15
- EBC-Wert: 4 bis 12
Was sind untergärige Biere?
Untergärige Biere werden in einer kalten Umgebung gebraut. Während der Gärung muss die Umgebungstemperatur zwischen vier und neun Grad Celsius betragen, damit die Hefe „arbeiten“ kann. Zudem handelt es sich bei untergäriger Hefe um einzelne Hefestämme, die sich nicht im Verbund an der Oberfläche des Bieres sammeln, sondern am Boden des Braubottichs.
Schwarzbier
Seine schwarze Farbe erhält das Bier durch die während des Brauprozesses verwendeten dunklen Malze, die bei hohen Temperaturen geröstet werden. Schwarzbier besitzt vielfältige Geschmacksnoten und meist einen vollmundigen Charakter, der vor allem zu deftigen Speisen passt.
- Alkoholgehalt: 5 Prozent
- Stammwürzgehalt: 11 bis 14 Prozent
- Bitterstoffgehalt: 20 bis 30
- EBC-Wert: 50 bis 60
Lagerbier
Das helle Lager besticht durch seine gelbe Färbung und ist vergleichbar mit der Pilsener Brauart. Bei einem dunklen Lager werden stark geröstete Malze genutzt, die es vielfältig an Aromen machen. Das Export ist ebenfalls sehr malzbetont und weltweit bekannt. International wird der Begriff Lager gern als Sammelbegriff für nahezu alle untergärigen Vollbiere eingesetzt.
- Alkoholgehalt: 4 bis 7 Prozent
- Stammwürzegehalt: 11 bis 14
- Bitterstoffgehalt: 5 bis 25
- EBC-Wert: 4 bis 16
Pilsener
Das Pils ist das meistgetrunkene Bier Deutschlands. Es ist sehr hopfenbetont, schlank und spritzig im Geschmack. Die Schaumkrone ist fein und schneeweiß. Die optimale Trinktemperatur liegt zwischen sieben und acht Grad Celsius. Die Vorzeigebiere der meisten Traditionsbrauereien sind Pilsener.
- Alkoholgehalt: 4 bis 5 Prozent
- Stammwürzegehalt: 10 bis 12 Prozent
- Bitterstoffgehalt: 30 bis 45
- EBC-Wert: 4 bis 6
Weitere Biersorten
Neben den standardmäßigen ober- und untergärigen Bieren, die nach dem Reinheitsgebot gebraut werden, gibt es diverse andere Biersorten zu kaufen.

Leichtbier
Leichtbiere, die oft den Namenszusatz „Light“ haben, sind kalorienarm und haben etwa 40 Prozent weniger Brennwert sowie Alkohol als Vollbiere. Der Alkoholgehalt beträgt zwischen 2,0 und 3,2 Prozent. Während der Gärung wird die Bildung von Alkohol entweder gebremst oder dem Bier nach der Gärung entzogen. Auf diese Weise wird auch bei der Herstellung von alkoholfreiem Bier verfahren.

Alkoholfreies Bier
Diese Biersorte wird ebenfalls nach dem Reinheitsgebot gebraut und enthält maximal 0,5 Prozent Alkohol. Nach dem deutschen Lebensmittelrecht gilt sie somit als alkoholfrei, da das Getränk, ebenso wie Mischbrot oder Fruchtsäfte, einer natürlichen Gärung unterliegt. Es ist wissenschaftlich belegt, dass der Alkoholanteil keinen physiologischen Einfluss auf den menschlichen Körper hat. Einige Biere enthalten dennoch sogar 0,0 Prozent Alkohol.

Malzbier
Nährbiere oder auch Malztrünke genannt bestehen aus dunklem Malz, Zucker, Zuckerlikör und obergäriger Hefe. Die Gärung, die essenziell für die Herstellung von Bier ist, wird maschinell unterdrückt. Da diese nicht erfolgt ist, zählen sie gesetzlich nicht als Biere. Mit einem Alkoholgehalt von weniger als 0,5 Prozent gelten Malzbiere als alkoholfrei.
Craftbeer
Für Craftbeers gilt das Reinheitsgebot nicht. Somit entziehen sie sich der darauf basierenden Definition. Beer-Crafting ist ein Handwerk, bei dem Bier mit hochwertigen, alternativen Zutaten gebraut wird, wie zum Beispiel Aromahopfen, Kaffee- und Kakaobohnen sowie Orangenschalen. Auf diese Weise entstehen unkonventionelle Geschmacksrichtungen.
Für Beer-CrafterInnen stehen alte Brautraditionen im Vordergrund, die sich abseits des Reinheitsgebots auf die Kreativität der BraumeisterInnen und den individuellen Geschmack eines Bieres stützen. Craftbeers sind mittlerweile Trend-Getränke, die zusehends in Mode kommen und sich in alternativen Szenen sowie unter Biersommeliers großer Beliebtheit erfreuen. Die Craft-Breweries, von denen einige mittlerweile international zu finden sind, stehen weiterhin den großen Braukonzernen gegenüber. Vielen Craftbeer-BraumeisterInnen ist es wichtig, den KonsumentInnen zu verstehen zu geben, dass es sich bei Craftbeer nicht nur um die Gesamtheit individueller Biersorten handelt, sondern dass es auch eine Einstellung gegenüber der Brautradition darstellt.

Die BraumeisterInnen missachten bewusst das Reinheitsgebot, da sie dieses als überholt ansehen. Sie berufen sich auf die kreative Braukultur von damals, als es noch üblich war, Bier mit Kräutern und diversen natürlichen Zutaten herzustellen. Statt des Reinheitsgebots postulieren sie ein Natürlichkeitsgebot.
Zu den beliebtesten und verbreitetsten Craft-Bier-Stilen gehören die folgenden:
Pale Ale: Dieses Ale ist ein helles, hopfenbetontes und obergäriges Bier aus Großbritannien. Oft wird der Begriff als Synonym für alle obergärigen Craft-Biersorten verwendet.
India Pale Ale: Ein IPA ist ein ebenfalls hopfenbetontes, obergäriges Bier, das stärker als Pale Ales ist. Es besitzt oftmals fruchtige Aromen und einen hohen Alkoholgehalt.
Porter: Porter unterscheiden sich geschmacklich sehr voneinander. Grundsätzlich handelt es sich aber um obergärige Biere von dunkler, tiefschwarzer Farbe mit malzigem Geschmack.
Stout: Bei diesem tiefschwarzen Bier steht das Malz im Fokus. Der Hopfen ist eher zweitrangig, um der Malzsüße eine Bitternote entgegenzusetzen.
Gose: Das Bier ähnelt Berliner Weisse. Es ist säuerlich und aufgrund des Kochsalzes leicht salzig. Das Besondere an diesem erfrischenden Bier ist die Zugabe von Koriander.
Biermischgetränke
Wie es der Name bereits vermuten lässt, bestehen Biermischgetränke nur zum Teil aus Bier. Ihnen wird ein weiteres Getränk hinzugegeben. Entweder mischen Sie das Getränk selbst oder Sie kaufen es bereits abgefüllt. Mittlerweile stellt nahezu jeder große Braukonzern auch Biermischgetränke her, die vor allem im Sommer sehr beliebt sind.
Zu den geläufigsten Biermischgetränken gehören die folgenden:
Alster: In Norddeutschland ist das ein Bier, meist Pils, mit Zitronenlimonade. Andernorts wird stattdessen Orangenlimonade hinzugegeben.
Black Velvet: Dieser Biercocktail besteht zu gleichen Teilen aus dunklem Bier und Sekt.
Diesel: Bier, üblicherweise ein Pils, wird mit Cola gemischt. Das Mischverhältnis bleibt Ihrem Geschmack überlassen.
Monaco: Hier wird helles, obergäriges Bier mit einem Schuss Grenadinesirup oder -saft versetzt.
Potsdamer: Dem Bier, in der Regel ein Pilsener, wird rote Fassbrause hinzugegeben.
Radler: Hierbei handelt es sich um eine Bier-Limonade-Mischung; in Norddeutschland Orangenlimonade, andernorts auch Zitronenlimonade. Es gibt keine einheitliche Definition.
Trockenes Radler: Ein herkömmliches Bier wird mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser versetzt.
Immer wieder dieses „süffig“
„Süffig“ ist ein gern und viel genutztes Wort, wenn es darum geht, den Geschmack eines Bieres zu beschreiben. Die Definition des Dudens lautet: „angenehm schmeckend und gut trinkbar“. In diesem Sinne ist „süffig“ folglich eine subjektive Beurteilung, die Kenner alkoholischer Getränke individuell heranziehen, um ein wohlschmeckendes Bier zu charakterisieren.
Die Inhaltsstoffe
Nach dem Reinheitsgebot gebrautes Bier enthält kaum Zucker und weder Fette noch Salze. Im Craftbeer-Bereich kann es aufgrund der Individualität anders aussehen. Den Energiegehalt, also die Kalorien, erhält das Bier über den Alkohol, der während der Gärung entsteht. Zudem enthält Bier Kohlenhydrate und geringe Mengen Eiweiß.
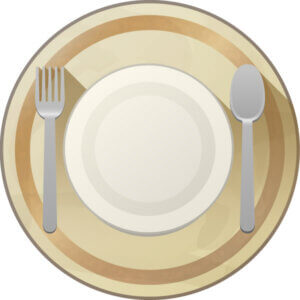
Kalorien
Die Kilokalorien eines Bieres beschreiben dessen Energiegehalt. Ein 300-Milliliter-Glas Pilsener enthält rund 130 Kilokalorien, während ein 500-Milliliter-Glas Hefeweizen über 200 Kilokalorien und damit bereits die gleiche Menge wie ein Drittel einer Tafel Schokolade hat. Der tägliche Energiebedarf unterscheidet sich von Mensch zu Mensch, zudem haben Männer einen höheren Bedarf als Frauen. Um den Energiehaushalt zu decken, sollten Sie auf eine ausgewogene Ernährung achten.

Kohlenhydrate
Auch Kohlenhydrate sind eine wichtige Energiequelle und für zahlreiche Stoffwechselvorgänge vonnöten. Sie bilden einen großen Teil der menschlichen Nahrung. Stärke ist eines der wichtigsten Kohlenhydrate und als energieliefernde Glucose-Einheit ein wichtiger Kohlenhydratspeicher. Sie lässt sich unter anderem in Getreide, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten finden. Je nach Sorte enthalten 100 Milliliter Bier ungefähr zwei bis fünf Gramm Kohlenhydrate.

Zucker
Zucker ist in den meisten Biersorten nur in Spuren enthalten und kommt sowohl als Einfach- als auch Zweifachzucker vor. Zwar liefert er schnelle Energie, er sorgt jedoch auch für ein bald wiederkehrendes Hungergefühl. Die tägliche Zuckerzufuhr in reguliertem Maße ist wichtig für eine gesunde Ernährung. 100 Milliliter eines Pils enthalten ungefähr 0,3 Gramm Einfach- oder Zweifachzucker.

Eiweiß
Proteine, die umgangssprachlich als Eiweiße bezeichnet werden, bestehen aus Aminosäuren, die der Körper benötigt, da sie wesentlicher Bestandteil von Zellen und Gewebe sind. In Lebensmitteln wie Milchprodukten, Fisch und Eiern sind Proteine enthalten. Bier hingegen besitzt nur wenig Eiweiß in schwankenden Mengen: Durchschnittlich kommt auf 100 Gramm Bier ein halbes Gramm Eiweiß. Von diesem Protein kann der Körper rund 65 Prozent verwerten.

Fett
Fette sind tierischen sowie pflanzlichen Ursprungs und bestehen aus Fettsäuren. Sie stellen einen wichtigen Energielieferanten dar und sind essenziell für den Körper. Zahlreiche Vitamine können nur über Fett aufgenommen werden; zudem macht es Speisen als Träger von Aromen erst schmackhaft. Gerste besitzt zwar kleine Mengen an Fett, welches jedoch beim Mälzen abgebaut wird. Deshalb ist in Bier kein Fett enthalten.
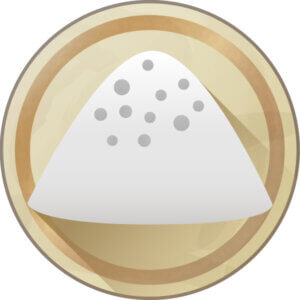
Salz
Bier ist ein Mineralstoff und lebensnotwendig, da der menschliche Körper Natriumchlorid, also Kochsalz, nicht selbst produzieren kann. Als tägliche Dosis empfehlen sich etwa sechs Gramm Salz, um das Nervensystem, die Verdauung und den Knochenaufbau zu unterstützen; auch für den Wasserhaushalt ist Salz entscheidend. In Bier ist Salz ebenfalls nur in geringen Spuren zu finden.
Die Trinkgefäße
Um Bier zu konsumieren, bedarf es eines entsprechenden Behälters. Bier wird in der Regel entweder in Flaschen oder in Fässern abgefüllt. Aus der Flasche können Sie es direkt trinken, während Sie das Fassbier in ein Glas füllen müssen. Biersommeliers setzen auch beim Flaschenbier auf den Genuss aus einem Glas.
Bierflaschen
Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben sich vier verschiedene Bierflaschen auf dem Markt etabliert:
Steinieflasche: Die Norm der Steinieflasche stammt aus dem Jahr 1953; sie fasst 0,3 Liter. Die braune Flasche ist klein, stabil und bauchig.
Euro-Flasche: Diese Flasche fasst 0,5 Liter und hat eine gerade Form, die sich nach oben hin verjüngt. Sie ist schwer, robust und hat dank des breiten Bodens einen sicheren Stand.
NRW-Flasche: Die Flasche, die erstmals in Nordrhein-Westfalen vertrieben wurde, ist schlank und handlich. Sie etablierte sich im Laufe der letzten Jahrzehnte als Standard.
Bügelflasche: Dank des Bügels brauchen die Flaschen keinen Kronkorken. Beim Öffnen ertönt das markante „Plopp“, das mittlerweile Kultstatus genießt.
Sind Bierdosen von Vorteil?
Entgegen dem Gerücht, dass Bierdosen die Qualität des Inhalts vermindern, verändert eine Dose nicht den Geschmack des Getränks. In einigen Situationen sind Dosen sogar von Vorteil; zum Beispiel sind sie für Licht undurchlässig, weshalb das Bier länger frisch bleibt. Außerdem lassen sie sich aufgrund des geringen Gewichts und der Stabilität gut transportieren Für einige Brauer sind die Aluminiumgefäße ein Statement: So nutzt zum Beispiel die Craftbeer-Szene gern Bierdosen, um sich von den Braukonzernen abzuheben und die Dose als Trinkgefäß bei der biertrinkenden Masse beliebter zu machen. Denn bis dato genießen Bierdosen einen eher schlechten Ruf und werden mit Billigbier sowie Alkoholismus in Verbindung gebracht. Auch wenn Dosen weniger nachhaltig als Glasflaschen sind und das Aluminium generell nicht gesundheitsfördernd ist, sind Bierdosen praktisch und schlicht.
Vorteile
- Lichtundurchlässig
- Geringes Eigengewicht
- Nicht zerbrechlich
Nachteile
- Weniger nachhaltig als Glasflaschen
- Aluminium ist nicht gesundheitsfördernd
- Geringes Ansehen in der Öffentlichkeit
Bierfässer
In der Herstellung besteht zwischen Fassbier und Flaschenbier kein Unterschied. Geschmacklich heben sie sich jedoch voneinander ab. Fassbier verfügt über fünf Prozent mehr Kohlensäure und wirkt deshalb frischer. Die höhere „Spritzigkeit“, die Sommeliers und Sommelièren als „Rezenz“ bezeichnen, macht das Fass bei vielen Biergenießern beliebter. Der Grund dafür ist simpel: Ein Fass hält mehr Druck aus als eine Flasche, weshalb dem Bier in einem Fass mehr Kohlensäure beigesetzt werden kann. Darüber hinaus ist ein Fass licht- und luftdicht verschlossen. Bierflaschen sind zwar meist dunkel eingefärbt, dennoch gelangt Sonnenlicht an das Bier und wenn die Flasche einmal geöffnet wurde, auch Luft. Die Folge ist, dass das Getränk schnell schal wird und ranzig schmeckt.
Deshalb ist auch die Qualität der Zapfanlage entscheidend: Bei der qualitativ minderwertigen Bierzapfanlage kann Kohlensäure aus dem Fass entweichen, wenn sich dieses leert. So wird auch das Bier im Fass schneller schal. Eine gute Zapfanlage stellt den benötigten Druck her, damit die Kohlensäure nicht entweichen kann. Damit die Anlage hygienisch sauber bleibt, sollten Sie diese regelmäßig reinigen.
Gläser
Wahre Biersommeliers trinken ihr Bier aus einem Glas, egal ob es zuvor in einer Flasche oder in einem Fass abgefüllt wurde. Erst in einem Glas entfaltet sich für den Kenner das volle Aroma. Darüber hinaus sehen Sie erst dann die Farbe des Biers und die Bildung der Schaumkrone. All diese Faktoren sind ausschlaggebend für die Bewertung eines guten Bieres.

Bierkrug: Diese klassische Form ist sehr klein und dicklich. An der Seite befindet sich ein Griff. Heutzutage gibt es auch schmale, hohe Krüge.
Export-Becher: Das Glas für Export-Bier hat eine neutrale Form und Ähnlichkeiten zum universell verwendbaren Willibecher.
Kölsch-Stange: Das schmale Gefäß fasst 0,2 Liter. Durch die Form geht weniger Kohlenstoffdioxid verloren und das Bier wird in der geringen Menge nicht schal.
Maßkrug: Der klassisch bayrische Krug ist auf dem Oktoberfest populär. Er fasst einen Liter und wiegt leer mehr als ein Kilogramm.
Pils-Tulpe: Dies ist das bekannteste Bierglas. Es gibt Variationen von hoch und schmal bis hin zu klein und dicklich.
Pint: Das Glas wird nach oben hin breiter. Diese Form ist besonders im englischsprachigen Raum verbreitet und wird bis zum Rand gefüllt. Die Schaumkrone wird abgestrichen.
Pokal: Hierbei handelt es sich um ein relativ flaches Glas, aus dem vorrangig Berliner Weisse, Trappistenbiere oder Abteibiere getrunken werden.
Craftbeer-Glas: Das Gefäß ist oben weit geöffnet, damit das Bier besonders gut atmen kann. Es wird gern zum Verkosten genutzt und am Stiel festgehalten.
Weißbierglas: Dieses hohe, geschwungene Glas fasst 0,5 Liter. Das Bier muss langsam eingeschenkt werden, da Weißbier zu starker Schaumbildung neigt.
Willibecher: Das dünnwandige Glas wird aufgrund seiner schnell abkühlenden Eigenschaften gern in der Gastronomie verwendet und gilt als „neutrales“ Bierglas für diverse Sorten.
Steinkrug: Der Vorfahre sämtlicher Biergläser findet heute kaum noch Verwendung. Stattdessen erfüllt er mit Aufdrucken repräsentative und dekorative Aufgaben.
Tipps für angehende Biersommeliers und -sommelière
Wer sich hobbymäßig an einer Bierverkostung probieren möchte, kann bereits mit wenigen Schritten zum Novizen-Sommelier oder zur Sommelière avancieren. Auch hier macht Übung den Meister oder die Meisterin. Es geht also im wahrsten Sinne des Wortes um das Probieren statt Studieren.
Das korrekte Einschenken
Spülen Sie das Glas vor dem Einschenken des Bieres unbedingt mit kaltem Wasser aus und bringen Sie es im Idealfall auf die gleiche Temperatur wie das Bier. Halten Sie die Flasche nun schräg zum Glas und gießen Sie das Getränk ein, bis die Schaumkrone den Rand erreicht. Lassen Sie das Glas anschließend stehen, damit sich der Schaum absetzen kann. Gießen Sie erst dann weiter nach. Alternativ können Sie auch das Glas schräg an die Flasche halten und das Bier schwungvoll eingießen. Auf diese Weise bildet sich die Schaumkrone erst, wenn Sie das Glas abstellen. Da die verschiedenen Biersorten zu unterschiedlich starker Schaumbildung neigen, sollten Sie auf den Alkoholgehalt achten. Bier mit niedrigem Alkoholgehalt haben eine stärkere Schaumentwicklung.
Die richtige Temperatur
Die ideale Trinktemperatur für den Großteil aller Biersorten liegt zwischen 7 und 9 Grad Celsius; dies entspricht einer normalen Kühlschranktemperatur. Manche Sorten entfalten erst bei einer leicht höheren Temperatur von 10 bis 14 Grad Celsius ihr volles Aroma. Für KennerInnen gilt, dass Biere weder zu schnell abgekühlt noch erwärmt werden sollten. Auf das rasche Kühlen in der Gefriertruhe verzichtet der Sommelier oder die Sommelière. Wenn das Bier zu kalt ist, bildet sich keine Schaumkrone; wenn es zu warm ist, schmeckt es schnell schal und schaumig.
Das Tasting-To-Do für Bier-Beginner
Wenn sich das Bier im Glas befindet, kann es beurteilt werden. Hieran sind mehrere Sinne beteiligt: Hören, Sehen, Riechen, Fühlen und Schmecken sind entscheidend für einen allumfassenden Eindruck.
Hören: Hören Sie, wie der Schaum knistert und die Kohlensäure prickelt. Achten Sie auch auf das gluckernde Geräusch des Bieres, wenn Sie es eingießen.
Sehen: Überprüfen Sie das Erscheinungsbild des Bieres: die Farbe, den Schaum, die Trübung. Sehen Sie, wie die Bläschen aufsteigen und eine Schaumkrone bilden.
Riechen: Prüfen Sie das Aroma und das Bouquet des Bieres. Hier erhalten Sie einen ersten Eindruck von der Süße, Säure oder Bittere des Getränks.
Schmecken: Nun wird der Gesamteindruck überprüft. Achten Sie auf die Ausgewogenheit der Aromen, die in ihre Nase steigen.
Berühren: Berühren Sie das Bier mit Gaumen und Zunge; prüfen Sie dessen Rezenz und wägen Sie ab, ob es eher vollmundig oder schlank ist. Spüren Sie das Prickeln der Kohlensäure.
Nachtasten: Achten Sie darauf, wie lang und intensiv die Komponenten nachwirken und ob sich die Bittere im Nachhinein aromatisch oder trocken äußert.
Reflektieren: Prüfen Sie nun den Gesamteindruck des Bieres und reflektieren Sie, ob es in allen Tasting-Phasen präsent war.
Weiterführende Testberichte
Achtung: Hierbei handelt es sich um einen Vergleich. Wir haben die Biere nicht selbst getestet.
Das Test- und Verbraucherportal ÖKO-TEST nahm 2020 insgesamt 42 Biersorten unter die Lupe. Die TesterInnen ließen die verschiedenen Biere in einem Labor untersuchen und überprüfen, ob sich daran Problemstoffe befinden. Unter anderem achteten die TesterInnen auf das Vorhandensein des gesundheitsschädlichen Stoffes Glyphosat, das gelegentlich in getreidehaltigen Lebensmitteln zu finden ist. Die Dosenbiersorten im Test überprüften die Laborarbeiter auf möglicherweise hormonell wirksame Stoffe wie Bisphenol A. Den Geschmack der Biere testeten die RedakteurInnen nicht, da er unter anderem von korrekter Lagerung abhängt, die sich je nach Getränkemarkt unterscheiden kann.
Das Ergebnis des Tests zeigt, dass die meisten Biere empfehlenswert sind. Mehr als die Hälfte der Sorten erhielt das Urteil „sehr gut“, unter anderem Astra Urtyp, Beck’s, Berliner Pilsner, Bitburger Premium Pils, Hasseröder Premium Pils, Holsten Pilsener Premium und Krombacher Pils. Zwölf Biere, darunter Flensburger Pilsener und Jever Pilsener, schnitten mit „gut“ ab, während 25 ein „sehr gut“ erhielten. Die schlechtesten Resultate im Test erzielten fünf Biersorten mit dem Testurteil „befriedigend“, darunter 5,0 Original Pils, Perlenbacher Premium Pils, Schultenbräu Pilsener, Stephans Bräu Pils Premium und Turmbräu Premium Pils. Grund dafür sind Glyphosat-Rückstände, eine schlechte Schaumqualität sowie mangelnde Nachhaltigkeit der Verpackung.
Abb. 1: © Netzvergleich | Abb. 2: © monticellllo / stock.adobe.com | Abb. 3–10: © Netzvergleich | Abb. 11: © Fxquadro / stock.adobe.com | Abb. 12–18: © Netzvergleich

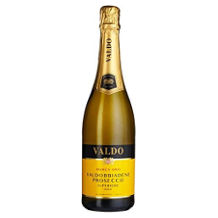

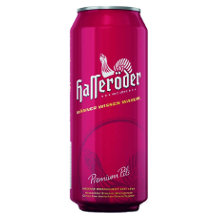
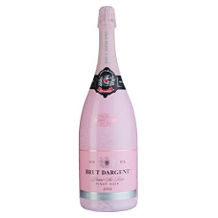







 373 Bewertungen
373 Bewertungen